Ergebnisse Nutzerinnenbefragung: Intermittierender Selbstkatheterismus (ISK) und Fremdkatheterismus (IFK) bei Frauen mit Querschnittlähmung
Im Jahr 2024 führte das Frauenhofer Institut Stuttgart unter der Leitung von Dr. Urs Schneider und unterstützt von der Manfred-Sauer-Stiftung, der Fördergemeinschaft der Querschnittgelähmten in Deutschland (FGQ) und dem Querschnittgelähmtenzentrum Bad Berka eine anonyme online-Befragung mit ISK- und IFK-Nutzerinnen durch.
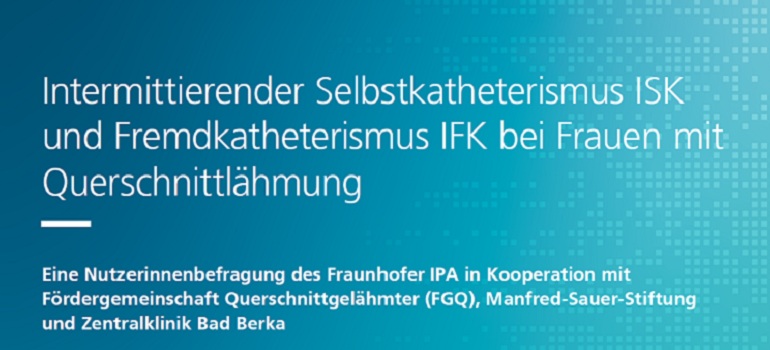
Es nahmen 103 Betroffene im Alter zwischen 18 und 80 Jahren teil. Beim überwiegenden Teil der Betroffenen waren weniger als 10 Jahre seit Eintritt der Querschnittlähmung vergangen. Die Hälfte der Befragten war unfallbedingt querschnittgelähmt. Dass eine kürzere ISK-Dauer mit einer geringeren Harnwegsinfektionsrate in der Studienpopulation signifikant korreliert, könnte mit unterschiedlichem Geschick bei der Durchführung, unterschiedlicher Sicht und unterschiedlicher Anleitung zusammenhängen.
Dass Frauen, die den ISK in einer Spezialklinik gelernt haben, eine signifikant geringere Harnwegsinfektionsrate aufweisen, könnte mit der Qualität von Anleitung und Training zusammenhängen. Diese Erkenntnisse sind aufgrund der begrenzt großen Studienpopulation aber mit Vorsicht zu betrachten. Die Ergebnisse zeigen Trends auf, auf welche in Zukunft in Bezug auf das Blasenmanagement bei Menschen mit NLUTD ein besonderes Augenmerk gelegt werden sollte. Der Katalog an Wünschen der Befragungsteilnehmerinnen umfasst u.a. Aspekte der Versorgung, der Katheter und der IK (Intermittierender Katheterismus)-Durchführung. Betroffene würden für Innovationen beim Katheterisieren eine längere Durchführungsdauer in Kauf nehmen.
Zusammenfassung der Ergebnisse
Es nahmen 103 Betroffene im Alter zwischen 18 und 80 Jahren teil (Durchschnittsalter 51 Jahre). Beim überwiegenden Teil der Betroffenen waren weniger als 10 Jahre seit Eintritt der Querschnittlähmung vergangen. Die Verteilung von Para- zu Tetraplegie lag bei 75 zu 23. Die Anleitung zum IK erfolgte 47x in Spezialkliniken, 25x zuhause, je 7x in einer urologischen Abteilung und einer Akutklinik.
Der ISK dauert bei den meisten (58%) weniger als 5 min und wird meist (67%) 4- bis 6-mal täglich durchgeführt. Die Befragten führten häufiger die Desinfektion als die Reinigung mit Wasser und Seife durch. Meist wurden gebrauchsfertige, beschichtete Katheter verwendet. Spiegel und separate Urinbeutel sind die meistverbreiteten Hilfsmittel. Die Sitzhaltung wird dabei von den meisten (58%) als stabil beschrieben.
ISK und IFK beeinflusste bei 55 der Befragten den Alltag mäßig bis stark, v.a. bezogen auf Restaurantbesuche, Besuche bei Freunden und Familie und Freizeitaktivitäten.
Zwei Zusammenhänge der Befragung sind statistisch signifikant:
- Eine kürzere ISK-Dauer geht mit einer geringeren Harnwegsinfektionsrate in der Studienpopulation einher.
- Personen, die den ISK in einer Spezialklinik gelernt haben, weisen eine geringere Harnwegsinfektionsrate auf.
Wünsche für die Zukunft
Die Betroffenen geben Wünsche für einen modernen ISK und IFK in den Feldern Versorgung, Katheter, ISK-Durchführung, Harnwegsinfektionen, Hygiene öffentlicher Toiletten und Umweltfreundlichkeit an. 40% der Befragten würden 1-3 min längere Durchführungszeit durch den Einsatz eines ergonomisch oder ggf. hygienisch verbesserten Hilfsmittels für den IK akzeptieren.
Zu Infektionen
51 der Befragten gaben eine Harnwegsinfektionshäufigkeit von 1 bis 3 pro Jahr an, 33 von mehr als 3 pro Jahr, wobei der Nachweis meist durch Urinschnelltests erfolgte. Präventionsmethoden sind bekannt. Die Hälfte der Befragten (50 von 103) geben die tägliche Trinkmenge mit 1000-1500ml an, sind also ggf. am unteren Ende.
Die Langfassung der Studie steht hier zum Download bereit.
Der-Querschnitt.de betreibt keine Forschung und entwickelt keine Produkte/Prototypen. Wer an der beschriebenen Methode oder den vorgestellten Prototypen Interesse hat, wendet sich bitte an die im Text genannten Einrichtungen.
