Posttraumatische Belastungsstörung bei Querschnittlähmung
Eine Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) zeigt sich oft erst Jahre nach einem traumatisierenden Lebensereignis wie zum Beispiel dem Eintritt einer Querschnittlähmung. Sie sollte ernst genommen und behandelt werden. Denn sie kann das soziale und berufliche Leben von Betroffenen erheblich einschränken. Bei querschnittgelähmten Menschen liegt die Wahrscheinlichkeit, eine PTBS zu entwickeln, deutlich höher als in der Durchschnittsbevölkerung.
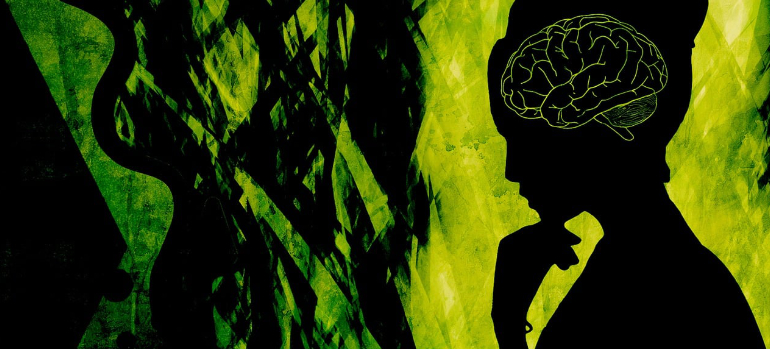
Etwa jeder zweite Mensch hat in seinem Leben eine traumatische Erfahrung. Das kann ein Autounfall sein, eine schwere Verletzung, ein körperlicher oder sexueller Übergriff, ein Kampfeinsatz oder eine Naturkatastrophe. Häufig gelingt es, das Trauma zu verarbeiten (siehe dazu auch Traumaverarbeitung nach Eintritt einer Querschnittlähmung – Der-Querschnitt.de). Durch das Trauma bedingte negative emotionale Reaktionen werden im Laufe der Zeit seltener oder verschwinden sogar ganz.
Posttraumatische Belastungsstörung trifft bis zu 60% der Menschen mit Querschnittlähmung
Bei manchen Menschen jedoch bleiben sie – oder tauchen Wochen, Monate, sogar Jahre später in Form einer Posttraumatischen Belastungsstörung wieder auf. Über alle Trauma-Arten gemittelt, erkranken etwa 10% aller von einem Trauma Betroffenen an einer PTBS, so das Informationsportal „Neurologen und Psychiater im Netz“.
Bei Menschen mit einer Querschnittlähmung ist die Zahl derer, die eine Posttraumatische Belastungsstörung entwickeln, deutlich höher. Das US-amerikanische MSKTC (siehe externer Link Home | MSKTC) hat zu diesem Thema ein Factsheet veröffentlicht: „Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) and Spinal Cord Injury“ (PTBS und Querschnittlähmung). Darin heißt es, dass in den USA 7 bis 9 Prozent aller Erwachsenen einmal in ihrem Leben von einer PTBS betroffen sind. „Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass PTBS bei Menschen mit einer Rückenmarksverletzung häufiger auftritt, nämlich bei 10 bis 60 %.“
Mögliche Faktoren, die bei Menschen mit Querschnittlähmung das Auftreten des PTBS begünstigen können:
- Ein traumatisches oder lebensbedrohliches Ereignis führte zur Rückenmarksverletzung
- Belastung durch chronische Schmerzen
- Schwere der Behinderung und ihrer Auswirkungen
- Vorhandensein psychischer Probleme bereits vor Eintritt der Querschnittlähmung
Andererseits weist das MSKTC in seinem Factsheet auch darauf hin, dass ein starkes Unterstützungssystem das Risiko einer PTBS verringern kann (siehe dazu auch Beitrag Diagnose Querschnittlähmung: Was, wenn ein Akzeptieren unmöglich scheint? – Der-Querschnitt.de).
Symptome der PTBS
Eine Posttraumatischen Belastungsstörung zeigt sich – nicht nur bei Querschnittlähmung – in verschiedenen Symptomen und Warnsignalen.
- Intrusion: Häufig werden durch einen – eventuell nur unbewusst wahrgenommenen – Schlüsselreiz (Trigger) unkontrollierbar wiederkehrende quälende Erinnerungen und das Wieder-Erleben der traumatischen Ereignisse hervorgerufen. Als heftigste Form der Intrusion gelten Flashbacks. Bei ihnen wird laut Wikipedia „der Betroffene plötzlich und mit voller Wucht ganz und gar in das Wiedererleben der traumatischen Situation hineingerissen und überwältigt“ und durchlebt sie nochmals mit allen Sinneseindrücken, „als würde sie gerade erneut real stattfinden“. Umgebungswahrnehmung, Ansprechbarkeit und Realitätskontrolle gehen in solchen Momenten völlig verloren.
- Vermeidung: Betroffene meiden aktiv Orte oder Aktivitäten, die an das erlittene Trauma erinnern könnten. Auch Gedanken an entsprechende Situationen oder Lokalitäten werden mitunter unterdrückt.
- Verdrängung: Wer unter PTBS leidet, kann manchmal wichtige Aspekte des traumatischen Erlebnisses nicht mehr (vollständig) erinnern.
- Negative Veränderungen von Kognition und Stimmung: Desinteresse und Abgehobenheit, verzerrte Wahrnehmung, Anhedonie (die Unfähigkeit, Freude oder Lust zu empfinden), Selbstbeschuldigungen und Depression können laut MSD Manual seelische Zustände sein, in denen eine PTBS sich manifestiert.
- Veränderungen der Erregung und Reaktivität: Eine PTBS kann sich auch in übermäßiger Erregung, Reizbarkeit und Reaktivität zeigen – oder in Gefühllosigkeit und Distanziertheit.
- Hypervigilanz (erhöhte Wachsamkeit): Ein Mensch mit PTBS kann unter permanenter Angst leiden oder ständig „auf der Hut“ sein, auch wenn keine Gefahr besteht.
- Schlaflosigkeit / Schlafstörungen / Alpträume
- Konzentrationsprobleme
Diagnose-Stellung
Wer den Verdacht hat, unter PTBS zu leiden, sollte sich helfen lassen. Im Internet gibt es zahlreiche Online-Test – viele Kliniken bieten sie an, aber auch die Bundeswehr (PTBS-Test). Das Ergebnis kann helfen, die eigene Befindlichkeit einzuordnen. Es kann vor allem auch der Beweggrundsein, sich professionelle Hilfe zu suchen.
Zur tatsächlichen Diagnosestellung ist ein Gespräch mit einem Psychologen oder Psychiater erforderlich. Behandelt wird PTBS meist in einer Psychotherapie, manchmal auch mit begleitender pharmakologischer Therapie.
Im Idealfall sollte der behandelnde Arzt/Psychologe Erfahrungen im Bereich Querschnittlähmung haben, betont das Factsheet der MSKTC. Da einige PTBS-Symptome wie Schlafstörungen auch körperliche Folgen einer Rückenmarksverletzung sein können, sei es wichtig, bei der Ermittlung der Ursache der Symptome alle Eventualitäten zu beachten und entsprechende Behandlungsmöglichkeiten auszuloten.
Wie schwierig die Ursachenfindung ist, stellt auch das MSD Manual klar. Es weist darauf hin, dass die posttraumatische Belastungsstörung oft übersehen werde. Das Trauma könne für den Arzt nicht offensichtlich sein, der Patient selbst vielleicht nicht bereit, über das Thema zu sprechen. Das Trauma könne „zu einem komplexen Wirbel von kognitiven, affektiven, verhaltensbezogenen und somatischen Symptomen führen“. Außerdem werde die Diagnose häufig durch das gleichzeitige Vorliegen einer Depression, Angststörung und/oder Substanzgebrauchsstörung erschwert.
Behandlungsmöglichkeiten
- Selbstfürsorge: Betroffene sollten „so weit wie möglich versuchen, einen gesunden Zeitplan für Essen, Schlafen und Bewegung einzuhalten. Substanzen und Medikamente, die sedierend (z. B. Benzodiazepine) oder berauschend (z. B. Alkohol) wirken, sollten, wenn überhaupt, nur sparsam eingesetzt werden“. Zudem wird dazu geraten, Risikoverstärker wie Stress, Langeweile, Ärger, Traurigkeit und Isolation aktiv zu bekämpfen.
- Psychotherapie – mögliche Therapieformen könnten sein:
- Trauma-fokussierte kognitive Verhaltenstherapie (CBT) mit dem Ziel einer kognitiven Umstrukturierung
- Verlängerte Exposition: Traumatische Erinnerungen werden angesprochen, die Reaktionen darauf mit Techniken wie der kontrollierten Atmung gesteuert.
- Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR): Diese Therapieform bringt mittels Augenbewegungen beide Gehirnhälften miteinander in Einklang. Eine Neubewertung der traumatischen Erfahrung wird ermöglicht.
- Pharmakotherapie: Meist werden Medikamente therapiebegleitend eingesetzt, unter anderem, um stark ausgeprägte PTBS-Symptome zu mildern. Hier bedarf es gerade bei Menschen mit Querschnittlähmung einer intensiven Absprache mit behandelnden Querschnitt-Spezialisten.
Dieser Text wurde mit größter Sorgfalt recherchiert und nach bestem Wissen und Gewissen geschrieben. Die genannten Produkte, Therapien oder Mittel stellen keine Empfehlung der Redaktion dar und ersetzen in keinem Fall eine Beratung oder fachliche Prüfung des Einzelfalls durch medizinische Fachpersonen.
Der-Querschnitt ist ein Informationsportal. Die Redaktion ist nicht dazu berechtigt, individuelle Beratungen durchzuführen.
