Hilfsmittel ist nicht gleich Hilfsmittel: Sechs Kategorien
Rollstuhl, Katheter, ein spezielles Bett, adaptiertes Besteck, ein rollstuhlgerecht umgebautes Auto: Jeder Mensch mit Querschnittlähmung braucht Hilfsmittel. Zuständig sind unterschiedliche Kostenträger, die entsprechenden Regelungen finden sich in diversen Verordnungen und Gesetzen. Im Folgenden werden sechs Hilfsmittel-Kategorien vorgestellt, die für Menschen mit Querschnittlähmung relevant sein können.
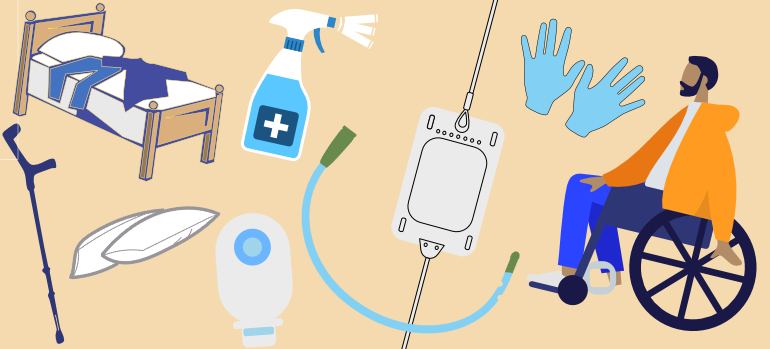
1. Hilfsmittel zum Ausgleich einer Behinderung
Eine der wichtigsten Hilfsmittel-Kategorien für Menschen mit Querschnittlähmung: Die Hilfsmittel zum „Ausgleich einer Behinderung“. Ihre grundsätzliche Definition ist recht einfach, ein Blick in das deutsche Sozialgesetzbuch genügt. § 33 SGB 5 (Einzelnorm) sagt: „Versicherte haben Anspruch auf Versorgung mit Hörhilfen, Körperersatzstücken, orthopädischen und anderen Hilfsmitteln, die im Einzelfall erforderlich sind, um den Erfolg der Krankenbehandlung zu sichern, einer drohenden Behinderung vorzubeugen oder eine Behinderung auszugleichen“. Sie können ersetzende, unterstützende oder entlastende Wirkung haben.
Wichtig ist in diesem Zusammenhang eine Einschränkung: Als Hilfsmittel gelten nur die Gegenstände, die „nicht allgemeine Gebrauchsgegenstände des täglichen Lebens sind.“ Hier gibt es immer wieder Änderungen, zum Beispiel im Bereich der Umfeldkontrolle: Dank wachsender Digitalisierung und des Siegeszugs der Smart-Home-Technologien gilt manches, was gestern noch Hilfsmittel war, vielleicht schon morgen als allgemeiner Gebrauchsgegenstand (siehe auch § 33 SGB 5 – Einzelnorm (gesetze-im-internet.de).
Bei gesetzlich Krankenversicherten ist nur teilweise eine Verordnung durch eine Vertragsärztin oder einen Vertragsarzt erforderlich, es besteht jedoch eine Genehmigungspflicht durch die Krankenkasse. Die Kosten für ein Hilfsmittel werden im Regelfall nur übernommen, wenn die Produkte im Hilfsmittelverzeichnis aufgeführt sind. Gut begründete Ausnahmen sind jedoch möglich. Ebenfalls wichtig zu wissen: Wer sich für ein Hilfsmittel oder zusätzliche Leistungen entscheidet, die über das Maß des Notwendigen hinausgehen, muss die Mehrkosten – und eventuelle Folgekosten bei Reparaturen und ähnlichem – selbst tragen (siehe §33 Sozialgesetzbuch 5, Abs. 1 Satz 6).
Generell wird zwischen zwei Arten von Hilfsmitteln zum Behinderungsausgleich unterschieden: Hilfsmittel zum unmittelbaren Behinderungsausgleich und Hilfsmittel zum mittelbaren Behinderungsausgleich.
Der unmittelbare Behinderungsausgleich dient dazu, eine verloren gegangene oder beeinträchtigte Körperfunktion wieder möglich zu machen, zu ersetzen oder zumindest zu erleichtern. Ein Beispiel sind Exo-Skelette, mit deren Hilfe inkomplett gelähmte Menschen wieder stehen und gehen können. Bei Hilfsmitteln aus dieser Kategorie wird davon ausgegangen, dass sie „der Befriedigung eines sogenannten allgemeinen Grundbedürfnisses des täglichen Lebens dienen“ und damit für einen möglichst weitgehenden Behinderungsausgleich sorgen (siehe § 47 SGB IX – Einzelnorm).
Zu den Hilfsmitteln für den mittelbaren Behinderungsausgleich zählen z. B. Badewannenlifter, Duschhocker, Sitzschalenstühle, Toilettenstühle, Alltagshilfen, für die Behinderung adaptierte Computer – und Rollstühle. Sie gleichen indirekt die Folgen einer Behinderung aus: Ein Rollstuhl befähigt einen Menschen mit Querschnittlähmung nicht dazu, zu gehen – aber er sorgt dafür, dass er mobil ist. In diesem Fall muss gesondert geprüft werden, ob das Hilfsmittel der Befriedigung eines allgemeinen Grundbedürfnisses des täglichen Lebens dient. Nur dann besteht ein Anspruch gegenüber der Krankenkasse, betont zum Beispiel die „Lebenshilfe“.
Die Unterscheidung zwischen mittelbar und unmittelbar kann handfeste Konsequenzen haben: So wurde einem querschnittgelähmten jungen Mann nach einem Rechtsstreit ein Exo-Skelett genehmigt (besser gesagt: Die Krankenkasse wurde dazu verurteilt, den Antrag zu genehmigen), weil es dem unmittelbaren Behinderungsausgleich dient. Hätte das Gericht das Exo-Skelett der Kategorie „mittelbar“ zugeordnet, hätte der Kläger keine Chance gehabt, denn mit Hilfsmitteln zum mittelbaren Behinderungsausgleich (Rollstuhl, Stehtrainer) war er bereits versorgt (siehe dazu Urteil: Exoskelett dient als Hilfsmittel dem unmittelbaren Behinderungsausgleich).
Da Hilfsmittel, die dem Ausgleich einer Behinderung dienen, nicht in erster Linie dazu dienen, auf eine Erkrankung therapeutisch einzuwirken, hat die Krankenkasse zwei Monate Zeit, um über den Antrag zu entscheiden. Die Frist verlängert sich, wenn die Krankenkasse schriftlich Gründe und den genauen Tag nennt, an dem mit einer Entscheidung zu rechnen ist. Lässt die Krankenkasse die erste Frist verstreichen, gilt das Hilfsmittel theoretisch als bewilligt und muss übernommen werden – man könnte sich das Hilfsmittel also auf eigene Kosten kaufen und dann das Geld zurückfordern. Wer sich zu diesem Vorgehen entschließt, sollte sich allerdings seiner Sache seeeeeehr sicher und/oder sehr gut beraten sein, denn die Erstattungsplicht gilt zum Beispiel nicht, „wenn und soweit kein Anspruch auf Bewilligung der selbstbeschafften Leistungen bestanden hätte“ (siehe § 18 SGB IX ).
Für gewöhnlich müssen gesetzlich Versicherte zehn Prozent des von der Krankenkasse zu übernehmenden Betrags zuzahlen, wobei der Betrag nach oben und unten gedeckelt ist: mindestens fünf, maximal zehn Euro.
2. Zum Verbrauch bestimmte Hilfsmittel
Eine kleine Sonderrolle nehmen die Hilfsmittel ein, die zum Verbrauch bestimmt sind – zum Beispiel Inkontinenzhilfen, Katheter, Stomaartikel, Sonden oder Spritzen. Hier zahlen gesetzlich Versicherte zehn Prozent der Kosten pro Packung dazu, maximal jedoch zehn Euro für den gesamten Monatsbedarf an solchen Hilfsmitteln.
3. Pflegehilfsmittel
Pflegehilfsmittel sind Geräte und Sachmittel, „die zur Erleichterung der Pflege oder zur Linderung der Beschwerden des Pflegebedürftigen beitragen oder ihm eine selbständigere Lebensführung ermöglichen, soweit die Hilfsmittel nicht wegen Krankheit oder Behinderung von der Krankenversicherung oder anderen zuständigen Leistungsträgern zu leisten sind.“ (siehe § 40 SGB 11 – Einzelnorm).
Auch hier wird zwischen zwei Kategorien unterschieden, nämlich zwischen technischen Pflegehilfsmitteln, wie beispielsweise einem Pflegebett, Lagerungshilfen oder einem Notrufsystem, und Hilfsmitteln zum Verbrauch (siehe Punkt 4).
Pflegehilfsmittel müssen bei der Pflegekasse beantragt werden, diese wiederum hat nach Antragseingang drei Wochen Zeit, um zu entscheiden. Wird ein medizinisches Gutachten benötigt, verlängert sich die Frist auf fünf Wochen. Auch hier gilt: Kann die Pflegekasse die Frist nicht einhalten, muss sie dies rechtzeitig schriftlich mitteilen und begründen. „Unterbleibt diese Mitteilung, gilt die Leistung nach Ablauf der Frist als genehmigt“, so das Bundesgesundheitsministerium.
Die sogenannte Pflegebegutachtung geschieht durch den Medizinischen Dienst (siehe auch Beitrag Der Medizinische Dienst: Zuständig für den Pflegegrad, für Hilfsmittel – und vieles mehr – Der-Querschnitt.de) oder durch Gutachter, die von der Pflegekasse beauftragt werden. Ihr Gutachten gilt – sofern der Betroffene zustimmt – als Antrag auf die Leistungen und zugleich als Beweis, dass die beantragten Mittel tatsächlich benötigt werden. Auch Pflegefachkräfte können konkrete Empfehlungen zur Versorgung mit Hilfsmitteln oder Pflegehilfsmitteln abgeben, wodurch eine zusätzliche fachliche Prüfung durch die Pflege- oder Krankenkasse entfällt (siehe auch Beitrag Soll Wege und Wartezeiten sparen: Hilfsmittel und Pflegehilfsmittel ohne ärztliche Verordnung ).
Pflegehilfsmittel gibt es nicht umsonst: Bei technische Pflegehilfsmittel muss ein Eigenanteil von zehn Prozent (maximal 25 Euro) bezahlt werden – größere Gegenstände werden oft aus Kostengründen leihweise überlassen.
4. Zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel
Technische Pflegehilfsmittel können lange genutzt werden. Aber es gibt auch Pflegehilfsmittel, die zum Verbrauch bestimmt sind. Wer einen Pflegegrad hat, hat nach § 40 SGB XI unter anderem Anspruch auf diese Pflegehilfsmittel, die zum einmaligen Gebrauch gedacht sind, weil sie aufgrund ihre Materialbeschaffenheit oder aus hygienischen Gründen in der Regel nur einmal benutzt werden. Wie lange, ist dabei unerheblich.
Der GKV-Spitzenverband nennt eine ganze Reihe von Hilfsmitteln, die unter diese Kategorie fallen: Saugende Bettschutzeinlagen, Schutzservietten, Fingerlinge, Einmalhandschuhe, medizinische Gesichtsmasken, Schutzschürzen, partikelfiltrierende Halbmasken, aber auch Desinfektionsmittel für Hände oder Flächen.
 Überschneidungen möglich
Überschneidungen möglich
Ob primär die Krankenkasse oder die Pflegekasse für die Bewilligung eines Hilfsmittels zuständig ist, ist oft nicht eindeutig zu entscheiden, viele Hilfsmittel könnten der einen, aber auch der anderen Kategorie zugeordnet werden. Im Zweifelsfall, so § 40 SGB 11 „prüft der Leistungsträger, bei dem die Leistung beantragt wird, ob ein Anspruch gegenüber der Krankenkasse oder der Pflegekasse besteht.“
Siehe dazu auch Beitrag „Alles aus einer Hand“: Teilhabeplan und Gesamtplan.
Für Hilfsmittel aus dieser Kategorie übernimmt die Pflegekasse die Kosten. Dabei gilt, dass die Kosten gemäß § 40 Absatz 2 SGB XI monatlich nicht mehr als 40 Euro kosten dürfen. Wer mehr Geld für Einmalhandschuhe oder ähnliches ausgibt, muss den Mehraufwand selbst zahlen, wer weniger ausgibt, hat keinen Anspruch auf Auszahlung der Differenz.
5. Hilfsmittel zur Teilhabe am Arbeitsleben
Neben den oben skizzierten Hilfsmitteln aus dem Bereich der medizinischen Rehabilitation gibt es auch Hilfsmittel zur Teilhabe am Arbeitsleben. Wichtigster Unterschied: Sie werden nur benötigt, um arbeiten zu können, beziehungsweise zur Arbeit zu gelangen. Dazu zählen laut § 49 SGB IX – Einzelnorm (gesetze-im-internet.de) u.a.
- die Kraftfahrzeughilfe nach der Kraftfahrzeughilfe-Verordnung (siehe: KfzHV – Verordnung über Kraftfahrzeughilfe zur beruflichen Rehabilitation (gesetze-im-internet.de),
- die Kosten für Hilfsmittel, die wegen Art oder Schwere der Behinderung erforderlich sind, um einen Beruf ausüben zu können, die Sicherheit auf dem Weg vom und zum Arbeitsplatz zu erhöhen sowie die Kosten technischer Arbeitshilfen, die wegen Art oder Schwere der Behinderung zur Berufsausübung erforderlich sind.
Ziel sei es, „die Erwerbsfähigkeit von Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohter Menschen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit zu erhalten, zu verbessern, herzustellen oder wiederherzustellen und ihre Teilhabe am Arbeitsleben möglichst auf Dauer zu sichern.“ Mögliche Kostenträger können die Bundesagentur für Arbeit sein, aber auch die gesetzliche Unfallversicherung, die Rentenversicherung oder Träger der Eingliederungshilfe.
6. Hilfsmittel für die soziale Teilhabe
„Leistungen zur sozialen Teilhabe von Menschen mit Behinderungen sollen gleichberechtigte Teilhabe in den Lebensbereichen ermöglichen, für die es keine anderen Leistungen zur Teilhabe und Rehabilitation gibt, z.B. beim Wohnen, beim Einkaufen, bei Behördengängen und in der Freizeit“, umschreibt betanet diese Gruppe. Hier finden sich Hilfsmittel, die weder Hilfsmittel nach § 33 SGB V noch nach § 40 SGB XI (siehe oben) sind. Die Leistungen ergänzen andere Leistungen aus dem Spektrum der medizinischen oder beruflichen Rehabilitation oder „werden gewährt, wenn andere Hilfen nicht in Betracht kommen“.
Neben nicht-sächlichen Leistungen wie Assistenz können auch konkrete Hilfsmittel in diese Kategorie fallen, zum Beispiel barrierearme Computer (siehe § 84 SGB IX). Es geht um Gegenstände, die je nach Grad der Behinderung die Teilhabe am sozialen Leben überhaupt erst möglich machen, zum Beispiel um Spezialschalter für die Waschmaschine, Haltevorrichtungen für Geräte oder auch Bedienungseinrichtungen für Kraftfahrzeuge (Voraussetzung: Der behinderte Mensch kann nachweisen, dass er wegen der Art und Schwere seiner Behinderung auf ein Kraftfahrzeug angewiesen ist).
Aber auch Sportrollstühle können unter diese Kategorie fallen, wie ein Urteil aus dem Jahr 2020 beweist, nach dem einem querschnittgelähmten 27-jährigen ein entsprechendes Sportgefährt genehmigt werden musste, damit er am Vereinssport teilnehmen kann (siehe Beitrag Querschnittgelähmter klagt erfolgreich: Sozialhilfeträger muss Sportrollstuhl zahlen). § 84 SGB IX – Einzelnorm (gesetze-im-internet.de).
Wer in welchem Umfang Anspruch auf welches Hilfsmittel hat, ist nicht gesetzlich geregelt, sondern muss jeweils im Einzelfall im sogenannten Teilhabeplanverfahren geklärt werden. Für die Finanzierung können verschiedene Träger zuständig sein, z.B. der Unfallversicherungsträger, der Träger der Kinder und Jugendhilfe oder der Träger der Eingliederungshilfe (siehe auch Beitrag Eingliederungshilfen: Vermögensfreibeträge statt Mittellosigkeit).
Dieser Text wurde mit größter Sorgfalt recherchiert und nach bestem Wissen und Gewissen geschrieben. Unter keinen Umständen ersetzt er jedoch eine rechtliche oder fachliche Prüfung des Einzelfalls durch eine juristische Fachperson oder Menschen mit Qualifikationen in den entsprechenden Fachbereichen, z.B. Steuerrecht, Verwaltung.
Der-Querschnitt.de führt keine Rechtsberatung durch.
Ob und in welchem Umfang private Krankenkassen die Kosten für Hilfsmittel, Therapien o.ä. übernehmen, ist individuell in der jeweiligen Police geregelt. Allgemeingültige Aussagen können daher nicht getroffen werden.
Am 06.07.2024 kommentierte ein Leser: „Als erstes einmal vielen Dank für Ihre informative und gut gemachte Seite. Ich lese seit mehreren Jahren Beiträge zu diversen Themen. So auch zu diesem Thema. Ich bin mir bewusst, dass der Löwenanteil Ihrer Leser gesetzlich versichert sein dürfte. Trotzdem würde ich mich gelegentlich darüber freuen wenn auch auf Regelungen für privat versicherte (soweit möglich) hingewiesen würde. Mit freundlichem Gruß – Philipp Leser“
Vielen Dank für diesen Hinweis. , den wir gerne aufgreifen würden. Aber in welchem Umfang und ob überhaupt private Krankenkassen die Kosten für Hilfsmittel, Therapien o.ä. übernehmen, ist individuell in der jeweiligen Police geregelt. Privatversicherte müssen immer einen Blick ins Kleingedruckte ihrer Police werfen. Die Redaktion
