Rolli-Garage: Wer zahlt? Darf Vermieter sie verbieten?
(Outdoor-)Rollstuhl, Rollator oder Handbike können nicht mit in die kleine Wohnung. Im Treppenhaus können die Hilfsmittel aber auch nicht stehen. Übernimmt in diesem Fall die Krankenkasse die Kosten für eine Rolli-Garage? Vielleicht sogar für eine kleine Solaranlage, um den Akku wieder aufzuladen? Mit diesen Fragen rund Kosten und Genehmigung einer Rolli-Box hat sich eine Leserin an Der-Querschnitt.de gewandt. Die Redaktion bat Jörg Albers, Fachanwalt für Sozialrecht, um eine Einordnung.
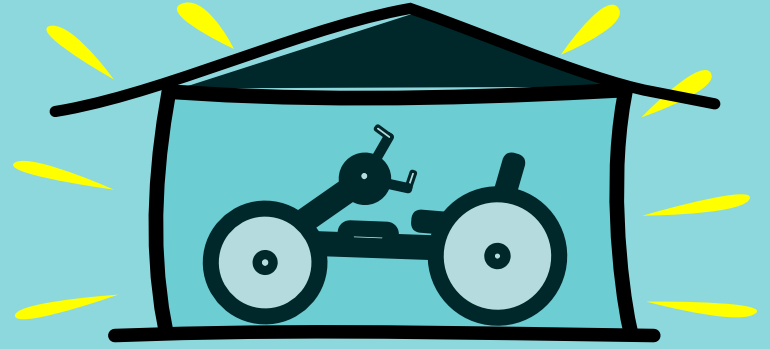
Sofern entsprechende Geh- oder Mobilitätshilfen für die Innenräume vorhanden sind, können in einer Rolli-Box alle Mobilitätshilfen verstaut werden, die nur draußen benutzt werden, inklusive schwerer Zusatzantriebe oder Rollstühlen, die als Sportgerät dienen.
Auf den ersten Blick scheint diese Lösung sehr praktisch zu sein: Es wird kein Abstellplatz in der Wohnung verschwendet. Man muss kein schweres Gerät durchs Treppenhaus oder in den Lift hieven – und der Hausflur bleibt sauber, weil das Outdoor-Equipment vor der Tür bleiben muss.
Ist diese Idee eine rein privates Nice-to-have? Oder haben Menschen mit Mobilitätseinschränkungen vielleicht sogar ein Anrecht darauf, dass ihnen die Krankenkasse eine Rolli-Box finanziert? Rechtsanwalt Albers kann diese erste Frage der Leserin mit einem klaren „Nein, aber“ beantworten.
Rolli-Box: Kein Hilfsmittel
Seine Einschätzung: Die Krankenkasse ist auf keinen Fall zuständig, weil eine Rolli-Garage definitiv kein Hilfsmittel ist und nicht zur Umfeldverbesserung in der eigenen Wohnung dient. Da die Box außerhalb der eigenen vier Wände steht, ist auch die Pflegekasse nicht zuständig.
Als letzte und vielversprechende Option bleibt die Eingliederungshilfe. Diese ist zwar nach wie vor Einkommensabhängig, aber die Limits liegen inzwischen relativ hoch (siehe auch Beitrag Eingliederungshilfen: Vermögensfreibeträge statt Mittellosigkeit – Der-Querschnitt.de). Viele scheuen nach Albers Erfahrung vor diesem Schritt zurück, weil die Eingliederungshilfe nach wie vor den Geruch der Sozialhilfe habe, „aber ich kann nur jedem raten, es zu versuchen. Das klappt ganz oft“.
Kann Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft dienen
Strittig sei oft die Frage, ob ein Rollstuhlnutzer ein Auto haben muss oder nicht (siehe Beitrag Leistungen zur Mobilität: Zuschüsse für Kauf und Umbau eines Autos – Der-Querschnitt.de). Bei einem geschützten Abstellplatz für den Rollstuhl könnte die Argumentation häufig einfacher fallen: „Der Rollstuhl muss ordentlich untergebracht werden, man kann dann mit wenig Aufwand an der Gesellschaft teilhaben. Einkaufen, Vereinsaktivitäten, soziales Engagement – der Gesetzgeber will ja fördern, dass Behinderte am Leben in der Gemeinschaft teilhaben können. Genau das könnte eine solche Garage bewirken.“
Gerade Handbikes seien derzeit schwer im Kommen, es sei leichter, sie bewilligt zu bekommen. Schließlich dienten sie „ganz explizit der Bewegung an der frischen Luft und der sportlichen Betätigung“. (Zum Thema gesellschaftliche Teilhabe durch einen zweiten Rollstuhl oder Zusatzausstattungen gibt es einige jüngere Urteile, siehe Querschnittgelähmter klagt erfolgreich: Sozialhilfeträger muss Sportrollstuhl zahlen – Der-Querschnitt.de sowie Urteil: Recht auf Versorgung mit einem motorunterstützten Handkurbelrollstuhlzuggerät – Der-Querschnitt.de.)
Aber wer ein solches Zweit- oder Zusatzgerät bewilligt bekommen hat, muss es dann eben auch irgendwo unterbringen.
Kann Vermieter Rolli-Garage verbieten?
Eine knifflige Frage. Erste Voraussetzung ist natürlich, dass auf dem Grundstück, auf dem sich der angemietete Wohnraum befindet, überhaupt eine Rolli-Box Platz finden würde. Grundsätzlich sei, so Albers, „alles erlaubt, was behinderungsbedingt nötig ist“. Es gebe aber sogenannte „Versagungsgründe“, deren Grenzen aber relativ hoch angesetzt seien – „da müssen Vermieter oder Eigentümergemeinschaft schon sehr gute Gründe haben“. Und die gibt es natürlich auch. So können baurechtliche Vorschriften greifen, wenn die Rolli-Box zum Beispiel Flucht- oder Rettungswege ganz oder teilweise verstellen würde.
Daneben kann auch das Gleichheitsprinzip greifen: „Ja, ihre Wohnung ist zwar klein, aber die anderen Mieter müssen zum Beispiel den Kinderwagen auch mit in die Wohnung nehmen“, skizziert Albers dieses Problemfeld. „Das sind die Fälle, die im Zweifelsfalle vor Gericht landen, und dann gibt es immer Einzelfallentscheidungen.“
Die Kosten für die Rolli-Box sind ganz allein Sache des behinderten Mieters, „woher das Geld kommt – selbstfinanziert oder über die Eingliederungshilfe-, muss dem Vermieter aber egal sein.“ Selbiges gilt auch für die Rückbau-Kaution, die ein Vermieter verlangen darf. Die gesetzliche Grundlage beider Regelungen findet sich im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB), siehe § 554 Barrierereduzierung, E-Mobilität, Einbruchsschutz und Steckersolargeräte.
Wer trägt die Energiekosten?
Für Rollstuhlnutzer, die in der Rolli-Box ihren E-Rollstuhl aufladen wollen, gilt prinzipiell dieselbe Lösung wie für das Aufladen in der Wohnung: Der Leistungsträger zahlt auch die Energiekosten – siehe Beitrag Strom für Hilfsmittel: Krankenkassen übernehmen die Kosten – Der-Querschnitt.de).
Bei Mehrparteien-Häusern muss man auf jeden Fall einen Zähler einbauen, damit die Mietergemeinschaft nicht mitbezahlt. Wer – wie viele Menschen mit Querschnittlähmung – eine Wohnung im Erdgeschoss hat, kann auch einfach ein Kabel rauslegen. Wer einen separaten Stromanschluss benötigt, kann, so Albers, diese in die Baukosten miteinrechnen. Übernimmt die Eingliederungshilfe die Kosten für eine Rolli-Box, werden auch die Baukosten erstattet.
Solaranlage: Problematisch
Wer sich auf die Rolli-Box eine kleine Solaranlage installieren will, um den E-Rolli mit ihrer Hilfe aufzuladen, fährt vermutlich besser, diese von vorneherein aus privater Tasche zu finanzieren. Eine kleine sogenannte Balkon-Anlage kostet relativ wenig Geld – „das hat man in spätestens in sechs Jahren wieder eingefahren“, sagt Albers – „und dann gehört einem die Anlage ganz einfach und man kann auch andere Geräte damit versorgen.“
Die Kosten für große Solaranlagen auf dem Dach werden übrigens grundsätzlich nie übernommen. Albers ist nur ein Fall bekannt, bei dem eine BG für einen Teil der Kosten aufkam.
Zur Person: Jörg Albers arbeitet in Berlin als Fachanwalt für Sozialrecht. Seine Kanzlei (externer Link) hat sich auf die Vertretung behinderter Menschen und auf sozialrechtliche Angelegenheiten spezialisiert.
Dieser Text wurde mit größter Sorgfalt recherchiert und nach bestem Wissen und Gewissen geschrieben. Unter keinen Umständen ersetzt er jedoch eine rechtliche oder fachliche Prüfung des Einzelfalls durch eine juristische Fachperson oder Menschen mit Qualifikationen in den entsprechenden Fachbereichen, z.B. Steuerrecht, Verwaltung.
Der-Querschnitt.de führt keine Rechtsberatung durch.
Ob und in welchem Umfang private Krankenkassen die Kosten für Hilfsmittel, Therapien o.ä. übernehmen, ist individuell in der jeweiligen Police geregelt. Allgemeingültige Aussagen können daher nicht getroffen werden.

